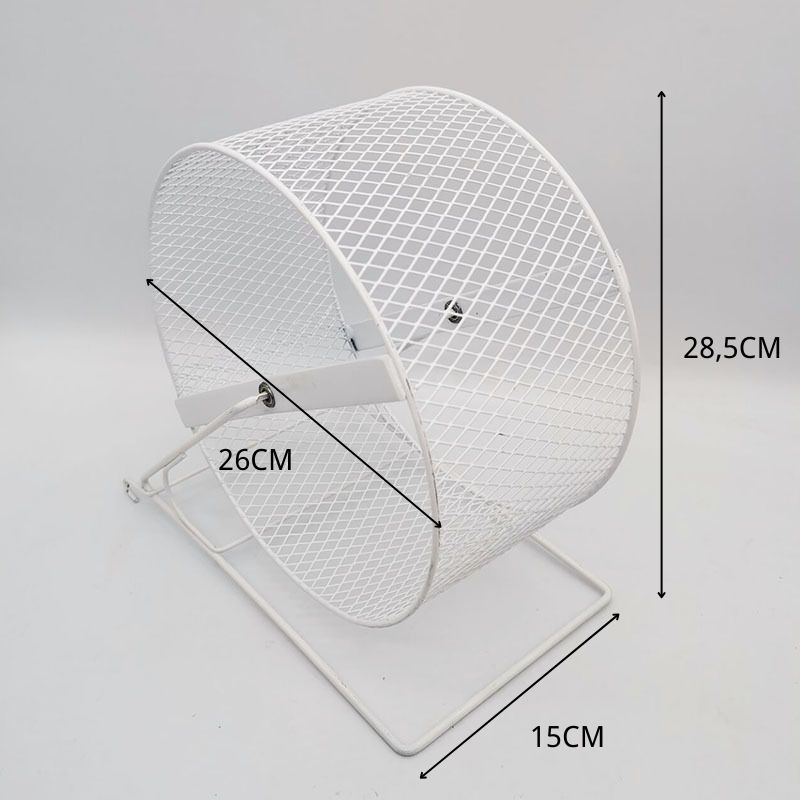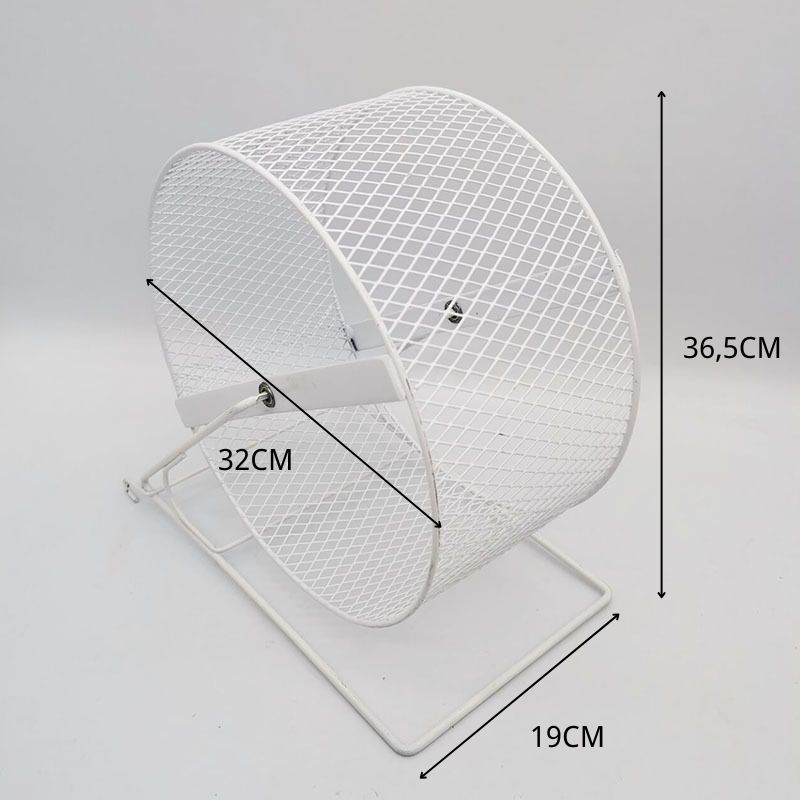Warum rammelt mein Hund mich?
Das sogenannte „Rammeln“ oder „Aufreiten“ bei Hunden ist ein Verhalten, das viele Hundebesitzer innen schon einmal beobachtet haben. Dabei springt der Hund auf das Bein, den Arm oder sogar den Rücken eines Menschen – manchmal auch auf Kissen, Decken oder andere Tiere – und macht rhythmische Bewegungen mit dem Becken. Dieses Verhalten kann sowohl bei Rüden als auch bei Hündinnen auftreten, unabhängig vom Alter oder davon, ob der Hund kastriert ist oder nicht.
Wichtig für Halter*innen ist es, die Häufigkeit und die Situation zu beobachten: Kommt es nur gelegentlich oder sehr häufig vor? Passiert es in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei Aufregung, bei Besuch oder beim Spielen? Zeigt der Hund dabei weitere Auffälligkeiten wie Hecheln, Winseln oder Unruhe? Solche Beobachtungen helfen, das Verhalten besser einzuordnen.
Warum machen Hunde das? Mögliche Ursachen
Das Rammeln ist ein vielschichtiges Verhalten und nicht immer ein Anzeichen für sexuelles Interesse. Hier sind einige Hauptgründe, warum Hunde dieses Verhalten zeigen können:
- Sexuelle Motivation: Besonders bei unkastrierten Hunden kann das Verhalten durch Hormone ausgelöst sein. Auch bei kastrierten Tieren kann ein Rest an Sexualtrieb vorhanden sein.
- Spielverhalten: Junge Hunde oder Hunde im Spiel können das Rammeln als Teil ihres natürlichen Spielverhaltens zeigen.
- Stress oder Aufregung: In neuen, aufregenden oder stressigen Situationen zeigen manche Hunde dieses Verhalten als Ventil, um Spannungen abzubauen.
- Aufmerksamkeitssuche: Manche Hunde haben gelernt, dass sie durch dieses Verhalten eine Reaktion – ob Lachen, Schimpfen oder Aufmerksamkeit – von ihren Menschen bekommen.
- Dominanzverhalten: Manche Experten sehen darin auch eine Art, Dominanz zu zeigen, wobei das Thema in der Wissenschaft umstritten ist.
- Übererregung oder Frustration: Wenn ein Hund überfordert oder unterfordert ist, kann Rammeln ebenfalls als Kompensationsmechanismus auftreten.
Muss ich das Verhalten korrigieren?
Ob und wie das Verhalten korrigiert werden sollte, hängt von den Ursachen und der Intensität ab. In vielen Fällen ist gelegentliches Aufreiten harmlos. Dennoch gibt es gute Gründe, dieses Verhalten nicht einfach zu ignorieren:
1. Unangenehm für Menschen: Viele Menschen empfinden das Verhalten als peinlich oder störend – besonders vor Gästen oder Kindern.
2. Verstärkung durch Aufmerksamkeit: Wenn das Rammeln Aufmerksamkeit bringt, wird es oft häufiger gezeigt.
3. Übertragung auf andere Hunde oder Menschen: Ein Hund, der das Verhalten nicht reguliert, kann es auch bei anderen Hunden oder fremden Personen zeigen, was zu Problemen führen kann.
4. Anzeichen für Stress: Wenn hinter dem Verhalten Stress oder Überforderung steckt, sollte die Ursache erkannt und behoben werden, um das Wohlbefinden des Hundes zu fördern.
5. Soziale Konflikte: In Mehrhundehaushalten kann häufiges Rammeln zu Auseinandersetzungen unter Hunden führen.
Eine konsequente, aber liebevolle Korrektur und das Umlenken auf erwünschtes Verhalten sind in den meisten Fällen ratsam, um das Zusammenleben angenehm und stressfrei zu gestalten.
Welche Methoden helfen, das Aufreiten zu verringern?
Die Reduktion des sogenannten „Rammelns“ ist für viele Hundehalter*innen ein zentrales Anliegen – nicht nur, weil das Verhalten als störend empfunden wird, sondern auch, weil es auf tieferliegende Bedürfnisse oder Probleme beim Hund hinweisen kann. Im Folgenden werden bewährte Methoden vorgestellt, die dabei helfen können, die Häufigkeit des Aufreitens gezielt zu verringern. Es wird erklärt, warum diese Methoden wirksam sind und wie sie konkret im Alltag umgesetzt werden können.
1. Kastration oder Sterilisation – Sinnvoll oder nicht?
Warum kann Kastration helfen?
Das Aufreiten wird häufig mit dem Sexualtrieb des Hundes in Verbindung gebracht – besonders bei unkastrierten Rüden, aber auch bei Hündinnen. Durch die Kastration wird die Produktion bestimmter Sexualhormone, allen voran Testosteron, deutlich reduziert. Testosteron ist maßgeblich an der Steuerung des Sexualverhaltens beteiligt und steht bei vielen Hunden in Zusammenhang mit vermehrtem Aufreiten, Markierverhalten und gelegentlich auch mit Aggression.
Durch die operative Kastration (bei Rüden die Entfernung der Hoden, bei Hündinnen die Entfernung der Eierstöcke) sinkt der Hormonspiegel, und viele Hunde zeigen bereits Wochen nach dem Eingriff eine deutlich verminderte Tendenz zum Aufreiten.
Wann ist die Kastration sinnvoll?
- Wenn das Verhalten sexuell motiviert ist: Besonders bei jungen, geschlechtsreifen Rüden, die ständig versuchen, Menschen, andere Hunde oder Gegenstände aufzureiten, ist Kastration oft eine wirksame Methode.
- Bei übermäßiger sexueller Frustration: Manche Hunde leiden sichtbar unter ihrer Triebhaftigkeit, wirken unruhig, sind schlecht ansprechbar oder nervös. Hier kann die Kastration nicht nur das Aufreiten, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden verbessern.
Wann hilft Kastration weniger?
- Bei stress- oder aufmerksamkeitsbedingtem Rammeln: Wenn das Verhalten vor allem durch Stress, Unsicherheit, Spiel oder Langeweile ausgelöst wird, hilft die Kastration nur selten. In diesen Fällen bleiben die Auslöser bestehen, auch wenn der Sexualtrieb gemindert wird.
- Bei bereits „erlerntem“ Verhalten: Wenn das Aufreiten bereits zur Gewohnheit geworden ist und weniger mit Sexualtrieb zu tun hat, kann eine Kastration das Verhalten zwar abschwächen, aber nicht immer vollständig beseitigen.
Wie läuft die Kastration ab?
Der Eingriff wird in Vollnarkose durchgeführt und ist bei gesunden Tieren ein Routineverfahren. Nach einigen Tagen Schonung kehren die meisten Hunde zum Normalzustand zurück. Veränderungen im Verhalten können nach 2–8 Wochen beobachtet werden.
Mögliche Nebenwirkungen
Wie bei jeder Operation gibt es Risiken wie Infektionen, Nachblutungen oder Narkoseprobleme. Zudem kann es zu Veränderungen im Stoffwechsel, Gewichtszunahme oder Fellveränderungen kommen. Daher sollte die Entscheidung immer gemeinsam mit einer Tierärztin oder einem Tierarzt abgewogen werden.
2. Training und Verhaltensänderung
Nicht jedes Aufreiten lässt sich durch medizinische Maßnahmen kontrollieren. Besonders wenn das Verhalten stress-, spiel- oder aufmerksamkeitsbedingt ist, kommen gezielte Trainingsmaßnahmen zum Einsatz.
a) Unerwünschtes Verhalten frühzeitig erkennen und unterbrechen
Sobald der Hund Anzeichen zeigt, dass er aufreiten möchte (z. B. Aufspringen, Fixieren, sich bereitmachen), sollte der Halter ruhig, aber eindeutig eingreifen. Ein kurzes, klares Stopp-Signal („Nein!“, „Aus!“) kann helfen. Wichtig ist, dabei ruhig zu bleiben und nicht zu schreien oder hektisch zu reagieren, da dies den Hund zusätzlich aufregen kann.
b) Umlenken auf erwünschtes Verhalten
Direkt nach dem Unterbrechen sollte dem Hund eine alternative Beschäftigung angeboten werden, z. B. ein Spielzeug, ein Suchspiel oder eine kleine Gehorsamsübung („Sitz“, „Platz“, „Schau mich an“). Dabei wird der Hund für das gewünschte Verhalten gelobt und belohnt. So lernt er, dass sich positives Verhalten für ihn lohnt.

c) Konsequenz und Geduld
Verhaltensänderung braucht Zeit. Wichtig ist, dass alle im Haushalt konsequent dieselben Regeln anwenden und das unerwünschte Verhalten immer gleich unterbrechen. Inkonsequenz führt dazu, dass der Hund verwirrt ist und das Verhalten schwerer ablegt.
d) Selbstkontrolle durch Impulskontrolltraining fördern
Viele Hunde reiten aus Übererregung oder mangelnder Impulskontrolle auf. Hier helfen Übungen, bei denen der Hund lernt, sich zu beherrschen und geduldig zu warten. Beispiele sind:
- Bleib-Übungen: Der Hund wird in „Sitz“ oder „Platz“ gebracht und muss abwarten, bis er ein Auflösekommando erhält.
- Anti-Jagd-Training: Hier lernt der Hund, Reizen wie vorbeilaufenden Tieren oder sich bewegenden Menschen zu widerstehen.
- Belohnung erst nach ruhigem Verhalten: Der Hund bekommt sein Futter, Spielzeug oder Aufmerksamkeit erst, wenn er ruhig ist.
e) Aufbau eines Alternativverhaltens
Manche Hunde profitieren davon, ein „Alternativverhalten“ zu lernen, das sie zeigen, statt aufzureiten. Das kann zum Beispiel ein „Sitz“, eine freundliche Begrüßung oder das Bringen eines Spielzeugs sein. Dieses Verhalten wird intensiv geübt und immer belohnt, wenn der Hund es von sich aus anbietet.
f) Management im Alltag
In manchen Situationen – etwa bei hohem Besuch, kleinen Kindern oder in der Öffentlichkeit – ist es sinnvoll, das Aufeinandertreffen mit dem Hund so zu gestalten, dass er gar nicht erst in Versuchung kommt. Hier helfen:
- Leine oder Hausleine: Der Hund bleibt angeleint, bis er sich beruhigt hat.
- Zeitweises Trennen: Der Hund wird für kurze Zeit in einen anderen Raum gebracht, um sich zu entspannen.
- Ruheorte schaffen: Ein fester Platz, an den sich der Hund zurückziehen kann, hilft, Übererregung abzubauen.
g) Professionelle Unterstützung
Bei sehr hartnäckigem oder problematischem Verhalten kann es ratsam sein, einen erfahrenen Hundetrainerin oder einen Verhaltenstherapeut*in zu Rate zu ziehen. Sie können individuelle Trainingspläne erstellen, Ursachen analysieren und bei der Umsetzung unterstützen.
3. Beschäftigung und Auslastung
Viele Hunde reiten aus Langeweile oder Überschuss an Energie auf. Deshalb ist es wichtig, den Hund ausreichend geistig und körperlich zu beschäftigen. Hier einige bewährte Möglichkeiten:
- Spaziergänge und Bewegung: Tägliche, abwechslungsreiche Spaziergänge, bei denen der Hund auch schnüffeln, forschen und sich austoben kann.
- Suchspiele und Nasenarbeit: Aufgaben, bei denen der Hund seine Nase einsetzen muss, fördern die Konzentration und machen müde. Eine besonders beliebte Möglichkeit, die Nase Ihres Hundes zu fordern, ist die Schnüffelmatte. In dieser Matte lassen sich kleine Leckerlis oder Futterstückchen verstecken, die der Hund durch gezieltes Schnüffeln aufspüren muss. Das Suchen und Erschnüffeln beschäftigt Ihren Vierbeiner nicht nur geistig, sondern lastet ihn auch körperlich aus.
- Intelligenzspiele und Tricks: Kleine Denkaufgaben, Tricks oder Gerätearbeit fördern die Kopfarbeit und lenken ab.
- Kontrollierte Sozialkontakte: Treffen mit anderen Hunden unter Aufsicht helfen, soziale Kompetenzen zu stärken und Energie abzubauen.

Ein ausgelasteter Hund ist weniger anfällig für unerwünschte Verhaltensweisen wie das Aufreiten.
Das Aufreiten („Rammeln“) des Hundes ist ein vielschichtiges Verhalten, das unterschiedlichste Ursachen haben kann – von Sexualtrieb über Stress bis hin zu Langeweile oder Aufmerksamkeitssuche. Für den Halter ist es zunächst wichtig, die Gründe für das Verhalten zu erkennen und die richtige Methode zur Korrektur oder Reduktion auszuwählen. Dabei helfen – je nach Ursache – medizinische Maßnahmen wie die Kastration, gezieltes Training, klare Regeln und Strukturen sowie ausreichend Beschäftigung und geistige Auslastung.
Langfristig ist das Ziel, dem Hund nicht nur das Aufreiten, sondern insgesamt gute Verhaltensweisen und Gewohnheiten beizubringen. Dabei stehen Geduld, Konsequenz und eine positive, wertschätzende Beziehung im Mittelpunkt. Mit dem richtigen Wissen, viel Einfühlungsvermögen und gegebenenfalls Unterstützung von Fachleuten gelingt es, ein harmonisches Miteinander zu schaffen, in dem sich Mensch und Hund gleichermaßen wohlfühlen.